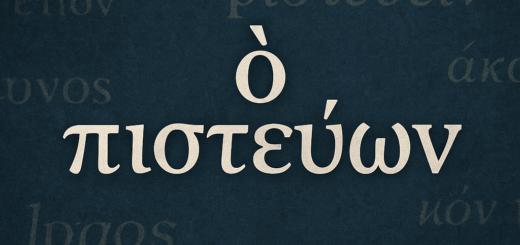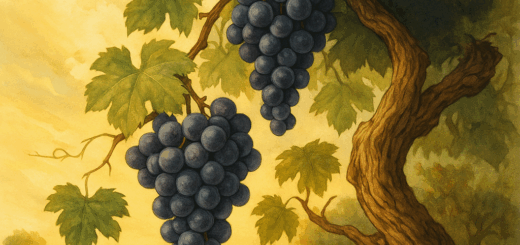Johannes 5,24 – Die Grammatik des Glaubens gegen die Free-Grace-Interpretation
In den theologischen Austauschrunden mit den Grace Guys (eine Gruppe von Vertretern der sogenannten Free-Grace-Lehre) – ob in Diskussionen über Römer 8,13, die Errettung im Johannesevangelium oder in unserer gemeinsamen Reflexion über die Sicherheit des Heils – kam Johannes 5,24 immer wieder als Schlüsselvers ins Spiel. Während die früheren Gespräche vor allem die theologische Dimension betrafen – etwa das Verhältnis von Gnade, Bleiben und Ausharren –, soll in diesem Artikel der Blick gezielt auf die grammatische Ebene gelenkt werden.
Die Lehre von der punktuellen Erettung
In den Gesprächen, mit den Grace Guys kam, wiederholt ein Gedanke auf, der die gesamte Diskussion prägte: die Vorstellung einer punktuellen Errettung – also die Annahme, dass das ewige Heil in einem einzigen Moment des Glaubens endgültig gesichert wird, unabhängig davon, ob dieser Glaube später bestehen bleibt oder nicht.
Bereits in meiner Debatte mit Paul von Gnade Pur wurde dieses Konzept deutlich formuliert. Er erklärte sinngemäß, dass jemand nach dem Moment des rettenden Glaubens nicht mehr an die Gottheit Jesu glauben müsse, um dennoch gerettet zu bleiben. Für ihn sei die Errettung an den Akt des Glaubens gebunden, nicht an ein fortdauerndes Vertrauen oder an bleibende Gemeinschaft mit Christus.
Diese Linie führte er in einem späteren Reaktions-Stream noch deutlicher aus. Dort sagte er wörtlich:
Man kann Atheist werden und trotzdem gerettet werden. Wenn die Bibel das sagt, dann ist es so – dann ist es wurscht, was für Gefühle wir dabei empfinden.
Damit ist die Kernaussage der Free-Grace-Position auf den Punkt gebracht: Ein einziger Glaubensmoment genügt für die endgültige Rettung; selbst wenn jemand später den Glauben völlig aufgibt, bleibe sein Heil bestehen.
In einem Versuch, diese Sicht auch grammatisch zu untermauern, bezog sich Josef – ein Mitstreiter von Paul bei Gnade Pur – in demselben Stream auf Johannes 5,24.
Er erklärte:
Der Präsens kann verschiedene Funktionen haben – progressiv, habitual, iterativ, gnomisch. Und genau das [gnomisch] haben wir hier in Johannes 5,24.
Josef versteht den Vers als gnomisches Präsens, also als allgemeine Wahrheit, die seiner Ansicht nach den Moment des Glaubens beschreibt – nicht den fortlaufenden Glauben. Wer in diesem Augenblick glaubt, so seine Sicht, empfängt das ewige Leben, und dieser Zustand bleibe bestehen, selbst wenn der Glaube später aufgegeben wird.
Der Begriff „punktuelles Präsens“ wird von Josef bewusst vermieden – wohlwissend, dass eine solche Kategorie in der griechischen Grammatik nicht existiert –, er interpretiert das Präsens jedoch de facto genau so, indem er es auf einen einmaligen Glaubensmoment beschränkt.
Zugleich gesteht er zu, dass auch eine progressive oder durative Lesart grammatisch möglich ist. Er bestreitet diese Möglichkeit nicht, sondern erklärt lediglich, dass er eine andere Deutung für plausibler hält. Damit anerkennt er, dass die Form des Textes eine fortlaufende Bedeutung keineswegs ausschließt.
Außerdem argumentierte er, dass eine fortlaufende Bedeutung nur dann vorliegen könne, wenn der Text Marker wie „jetzt“ oder „immer“ enthalte. Da diese fehlen, handle es sich – so Josef – nicht um eine dauerhafte Aussage.
Grammatische Analyse – Aspekt statt Zeitpunkt
Die entscheidende Schwäche in der Argumentation von Paul und Josef liegt in einer falschen Vorstellung davon, was das griechische Präsens tatsächlich ausdrückt. Im klassischen und neutestamentlichen Griechisch ist das Präsens keine Zeitform im modernen Sinn, sondern vor allem ein Aspekt – das heißt, es beschreibt die Art und Weise, wie eine Handlung gesehen oder dargestellt wird, nicht den Zeitpunkt, an dem sie geschieht.
1. Das Präsens beschreibt eine Perspektive, keinen Punkt
Wie Siebenthal in seiner Grammatik des neutestamentlichen Griechisch erklärt, zeigt das Präsens „eine Handlung in ihrem Verlauf“ und betont den inneren Ablauf – das nennt man den imperfektiven Aspekt (also eine Handlung, die fortdauert oder im Gang ist). Das Aorist-System dagegen stellt die Handlung als Ganzes dar – den perfektiven Aspekt (also etwas Abgeschlossenes).
Das Präsens richtet also den Blick auf die Linie, nicht auf den Punkt. Es ist wie eine laufende Filmaufnahme, nicht wie ein einzelner Schnappschuss. Man könnte sagen: Der Film besteht zwar aus vielen Einzelbildern, aber er zeigt Bewegung, nicht Stillstand. Daher ist es grammatisch ausgeschlossen, von einem „punktuellen Präsens“ zu sprechen – das wäre, als wollte man von einem „bewegten Standbild“ reden.
2. Marker sind optional, nicht definierend
Josef argumentierte, dass progressive oder gewohnheitsmäßige (habituale) Verwendungen des Präsens nur dann möglich seien, wenn bestimmte Marker wie „nun“, „jetzt“ oder „immer“ im Text stehen. Doch das ist laut sämtlicher Standardgrammatiken nicht korrekt.
So erklärt etwa Siebenthal (§ 195, S. 319), dass der Sprecher „eine Aspektnuance nicht allein grammatisch (durch die Wahl der Verbform) ausdrückt, sondern etwa durch adverbielle Ausdrücke zusätzlich stützt“. Porter (Idioms, S. 34 f.) formuliert es ähnlich: „Aspect is grammaticalized in the verb form itself; adverbials and contextual features may specify time but do not alter aspect.“ Und auch Wallace (Greek Grammar Beyond the Basics, S. 518 u. 614) betont, dass „the durative force of the present participle [is] inherent in the tense-stem and not dependent on adverbial qualifiers“.
Adverbien können also die Bedeutung verdeutlichen, sie aber nicht erzeugen oder verändern.
Beispiel: Jesus sagt in Joh 14,1: „Glaubt an Gott und glaubt an mich.“
Beide Verben stehen im Präsens-Imperativ, ohne Marker – und dennoch ist klar: Es geht um eine fortlaufende Haltung des Glaubens, nicht um einen einmaligen Moment.
Diese Beobachtung zeigt: Der Aspekt des Präsens hängt nicht von äußeren Markern ab, sondern ist in der Verbform selbst verankert. Damit entfällt ein zentraler Pfeiler von Josefs Argumentation – denn wenn Marker wie „jetzt“ oder „immer“ keine Bedingung für Dauerhaftigkeit sind, kann man die fortlaufende Bedeutung des Präsens auch ohne sie erkennen. An diesem Punkt versucht Josef, das Präsens anders zu deuten: nicht mehr als fortlaufend, sondern als gnomisch – also als allgemeine Wahrheit. Doch auch diese Lesart ändert nichts am grammatischen Aspekt des Präsens, wie sich im Folgenden zeigt.
3. Die gnomische Lesart – eine inkonsequente Anwendung
An diesem Punkt versucht Josef, die grammatische Schwierigkeit anders zu lösen. In Johannes 5,24 erklärt er das Präsens als gnomisch, also als allgemeine Wahrheit über den Moment des Glaubens. Nach seiner Auffassung handelt es sich dabei um eine sprichwörtliche Aussage – vergleichbar mit „Wer schreibt, der bleibt“. Der Satz beschreibe also keine fortlaufende Handlung, sondern eine allgemeine Regel: Wer in diesem Augenblick glaubt, empfängt das ewige Leben, und dieser Zustand bleibe bestehen.
Damit gebraucht Josef den gnomischen Präsens funktional so, als beschreibe er einen einzelnen Moment des Glaubens – obwohl diese Kategorie in der griechischen Grammatik nicht existiert. Er nennt ihn gnomisch, wendet ihn aber wie einen punktuellen Präsens an.
Doch genau hier liegt ein Missverständnis: Das gnomische Präsens bezeichnet im Griechischen keine einmalige Handlung, sondern eine zeitlose Wahrheit – etwas, das immer gilt, nicht etwas, das einmal passiert. Ein Beispiel ist „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ (Mt 4,4): Das beschreibt keine punktuelle Situation, sondern eine dauerhafte Realität. Wenn Josef also behauptet, das gnomische Präsens in Joh 5,24 beziehe sich auf einen einzelnen Moment des Glaubens, vermischt er grammatische Kategorie und theologischen Zweck. Das gnomische Präsens ist nie punktuell, sondern beschreibt etwas, das beständig wahr bleibt.
In Johannes 3,18 deutet er dasselbe Präsenspartizip jedoch völlig anders. Dort versteht er – gemeinsam mit Paul – das „der Glaubende“ substantivisch, also als Gruppenbezeichnung: die Glaubenden und die Nicht-Glaubenden. Das Präsenspartizip drücke demnach keine fortlaufende Handlung aus, sondern eine feste Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen – unabhängig davon, ob der Glaube später bestehen bleibt oder nicht.
Doch auch substantivisch gebrauchte Partizipien behalten ihren verbalen Charakter – und damit den imperfektiven Aspekt. Sie beschreiben also Handlungen im Verlauf, nicht abgeschlossene Ereignisse. Das Präsens bleibt fortlaufend, auch wenn es substantivisch verwendet wird.
Dieses Prinzip – dass der Aspekt (also die Blickrichtung oder Perspektive auf eine Handlung, ob sie fortläuft oder abgeschlossen ist) im griechischen Verb selbst verankert ist – bildet die gemeinsame Grundlage aller Standardgrammatiken.
Siebenthal (§ 195), Porter (Idioms, S. 34 f.) und Wallace (Greek Grammar Beyond the Basics, S. 518 u. 614) betonen übereinstimmend, dass der Sprecher den Aspekt nicht durch äußere Zusätze wie Adverbien oder syntaktische Rollen bestimmt, sondern dass er in der Verbform selbst kodiert ist.
Dasselbe Prinzip, das bereits beim Thema der sogenannten „Marker“ gilt – nämlich dass kein Adverb wie „jetzt“ oder „immer“ den durativen Sinn erst erzeugt –, gilt ebenso für den substantivischen Gebrauch des Partizips. Auch hier bleibt der Aspekt unverändert.
Josefs Wechsel zwischen „gnomisch“ und „substantivisch“ erklärt sich daher nicht aus der Grammatik, sondern aus einem theologischen Bedürfnis: Er will dieselbe Form so deuten, dass sie eine punktuelle Errettung stützt. Doch die griechische Sprache erlaubt diese Flexibilität nicht. Das Präsens bleibt in beiden Fällen durativ – es beschreibt kein punktuelles Ereignis, sondern eine anhaltende, lebendige Haltung des Glaubens.
4. Johannes 3,18 – ein starkes Gegenargument
Ein besonders klares Beispiel für die fortlaufende Bedeutung des Präsens findet sich in Johannes 3,18: „Wer glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet.“ Beide Ausdrücke – „der Glaubende“ und „der Nicht-Glaubende“ – stehen im Präsenspartizip und beschreiben zwei gegensätzliche, aber fortdauernde Zustände. Johannes zeichnet hier keine einmalige Szene, sondern zwei Lebensrichtungen: Der Glaubende befindet sich im Zustand des Lebens, der Nicht-Glaubende im Zustand des Gerichts.
Würde man die Free-Grace-Logik auf diesen Vers anwenden, ergäbe sich eine absurde Konsequenz: Man müsste sagen, „wer irgendwann einmal nicht geglaubt hat, ist für immer gerichtet“ – selbst wenn er später zum Glauben kommt. Das zeigt sofort, dass diese Lesart grammatisch wie theologisch unhaltbar ist. Denn ebenso wie das Gericht nur für den gilt, der fortdauernd ungläubig bleibt, gilt das Leben nur für den, der fortdauernd glaubt.
Im Reaction-Stream erkennen sowohl Josef als auch Paul an, dass dieses Argument grammatisch stark ist – Josef nennt es sogar ausdrücklich „ein gutes Argument“. Daraufhin greifen beide zu einer alternativen Deutung: Sie erklären, Johannes beschreibe hier lediglich zwei Kategorien – „die Glaubenden“ und „die Nicht-Glaubenden“. Das Präsenspartizip sei also nicht durativ gemeint, sondern substantivisch, als bloße Gruppenbezeichnung für Menschen, die geglaubt oder nicht geglaubt haben.
Damit umgehen sie jedoch den grammatischen Kern des Arguments (vgl. oben, Abschnitt 2 und 3). Wie dort gezeigt, behalten auch substantivisch gebrauchte Partizipien ihren verbalen Charakter – sie drücken weiterhin den Verlauf einer Handlung aus, keine bloße Zugehörigkeit.
Das wird besonders deutlich, wenn man sich ansieht, welche Alternativen Johannes gehabt hätte, um wirklich eine feste Gruppenzugehörigkeit auszudrücken: In Joh 20,29 („Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt“) verwendet er das Verb im Aorist, der eine abgeschlossene Handlung beschreibt – etwas, das einmal passiert und dann beendet ist. Oder er hätte, wie in Joh 9,22, einfach ein Substantiv verwenden können („Bekenntnis“), das eine Zugehörigkeit oder Eigenschaft ausdrückt, aber keine fortlaufende Handlung. Dass Johannes in Joh 3,18 und Joh 5,24 jedoch bewusst das Präsenspartizip wählt, zeigt, dass er nicht von einer statischen Gruppe spricht, sondern von Menschen, die im Glauben stehen und bleiben.
Damit ist der grammatische Befund eindeutig: Das Präsens beschreibt eine fortdauernde Handlung – und genau diese Dauerhaftigkeit trägt die theologische Bedeutung des Glaubens im Johannesevangelium.
Theologische Bedeutung
Die grammatische Analyse zeigt: Das griechische Präsens in Johannes 5,24 beschreibt keine punktuelle Handlung, sondern eine offene, andauernde Perspektive – eine Haltung, die fortbesteht. Damit fällt das gesamte System der „punktuellen Errettung“ in sich zusammen. Denn wer das Präsens durativ versteht, erkennt: Das „ewige Leben“ ist nicht das Resultat eines abgeschlossenen Moments, sondern das Geschenk einer bleibenden Vereinigung mit Christus.
Im Johannesevangelium ist „glauben“ nie nur intellektuelles Zustimmen, sondern eine existenzielle Teilhabe an Christus. Jesus spricht nicht von einem juristischen Akt, sondern von einer lebendigen Verbindung:
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.
(Joh 15,5)
Dasselbe Muster findet sich in 1 Joh 2,24–25:
„Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben.“
Hier ist das „Bleiben“ keine Zusatzstufe für besonders treue Christen, sondern der eigentliche Ort des Lebens. Glaube und Bleiben sind bei Johannes zwei Seiten derselben Wirklichkeit: Glaube ist das fortdauernde Hören, Vertrauen und Verweilen in Christus.
Die Free-Grace-Lehre löst diesen Zusammenhang auf. Sie trennt Rechtfertigung von Gemeinschaft, Glaube von Nachfolge, Leben von Bleiben. Sie reduziert die Gnade auf einen juristischen Statuswechsel, der keine Beziehung mehr erfordert. Damit widerspricht sie jedoch sowohl der Grammatik als auch dem Evangelium selbst.
Zur Begründung verweisen Vertreter der Free-Grace-Lehre häufig auf 2 Tim 2,15, wo Paulus sagt, man solle „das Wort der Wahrheit recht schneiden“. Zwar verstehen sie richtig, dass das griechische orthotomein „gerade schneiden“ bedeutet, doch sie wenden es falsch an: Statt das Wort geradlinig und im Zusammenhang auszulegen, zerschneiden sie es in getrennte Themen – Errettung, Jüngerschaft, Nachfolge, Gemeinschaft – und behandeln sie, als wären sie voneinander unabhängig. Gerade das aber widerspricht dem Sinn von orthotomein: Paulus fordert nicht, die Schrift zu zerlegen, sondern sie unverkürzt und aufrichtig weiterzugeben – ohne Trennung zwischen Glauben und Leben.
Zusammenfassung und Abschluss
Die Debatte um Johannes 5,24 zeigt exemplarisch, wie eng Grammatik und Theologie miteinander verwoben sind. Die Vertreter der Free-Grace-Lehre betonen zu Recht, dass das ewige Leben ein Geschenk der Gnade ist – unverdient, unerkauft, allein aus Gottes Güte. Doch sie verstehen dieses Geschenk als endgültig gesichert in einem einzigen Glaubensmoment. Der fortdauernde Glaube wird nicht geleugnet, aber er gilt in ihrem System nicht mehr als notwendig für die Rettung, sondern lediglich als Ausdruck der Gemeinschaft oder des geistlichen Wachstums.
Grammatisch jedoch lässt sich eine solche Sicht nicht stützen. Denn im Griechischen bezeichnet das Präsens keine abgeschlossene Handlung, sondern eine fortdauernde Wirklichkeit – und diese Wirklichkeit ist bei Johannes der lebendige Glaube selbst. Das griechische Präsens in Johannes 5,24 spiegelt genau das wider, was die Kirche lehrt: Glaube ist keine abgeschlossene Handlung, sondern eine fortdauernde Haltung der Gnade, in der der Mensch mit Christus verbunden bleibt.
Das Heil ist allein aus Gnade und kann durch kein menschliches Werk verdient werden. Doch die Gnade wirkt nicht außerhalb der Beziehung zu Christus. Sie schenkt nicht nur einen juristischen Status, sondern das Leben selbst – und dieses Leben bleibt nur in der Verbindung mit Jesus bestehen. Wer sich vom Glauben abwendet, trennt sich nicht von einem Vertrag, sondern vom Ursprung des Lebens.
So zeigt sich: Die Free-Grace-Lehre betont mit Recht den gnädigen Charakter des Heils, aber sie löst ihn von der Quelle der Gnade selbst. Sie erkennt den Anfang des Glaubens, aber nicht seine Natur als bleibende Beziehung.
Das Evangelium jedoch spricht von mehr:
Wer glaubt, bleibt. Und wer bleibt, lebt.
Johannes 5,24 verkündet keine einmalige Transaktion, sondern eine bleibende Teilhabe am göttlichen Leben. Das Präsens ist kein Punkt, sondern ein Strom – kein juristisches Dokument, sondern die Bewegung des Lebens selbst.
Die Gnade rettet nicht durch Erinnerung, sondern durch Gegenwart – nicht weil man einmal geglaubt hat, sondern weil man in dem lebt, an den man glaubt. So spricht Johannes nicht von einem vergangenen Moment, sondern von einem gegenwärtigen Leben im Sohn.