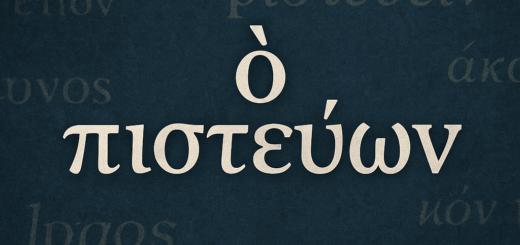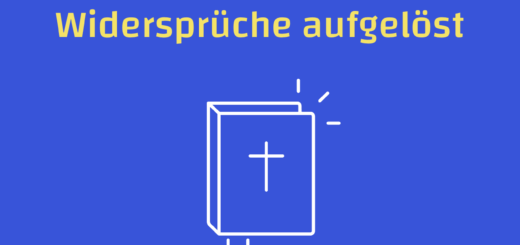Ewiges Leben nach Johannes 5,24 – Warum Free Grace scheitert
Einleitung
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen.
(Johannes 5,24)
Kaum ein Vers wird von Vertretern der Free-Grace-Lehre so häufig zitiert wie Johannes 5,24. Immer wieder wird er als Beweis angeführt, dass das Heil durch einen einmaligen Glaubensakt ein für alle Mal gesichert sei. Vertreter dieser Lehre betonen ausdrücklich, dass das Ausharren im Glauben keine Bedingung für die endgültige Rettung sei. Selbst Abfall, das bewusste Verleugnen Christi oder ein dauerhaftes Verharren in der Sünde führten ihrer Meinung nach nicht zum Verlust des Heils.
Dabei würden sie nicht leugnen, dass Dinge wie Heiligung, Ausharren und Treue wichtig sind. Doch in ihrem System betreffen diese nicht das ewige Heil, sondern allein die Gemeinschaft mit Christus, die Freude im Glaubensleben oder den Lohn im kommenden Reich. Genau hier setzt ihre Auslegung von Johannes 5,24 an – und genau hier zeigt sich, wie sehr sie den Text isolieren und seine Tragweite verkürzen.
Gerade deshalb haben wir in unserem Stream diesen Vers genauer betrachtet. Denn Free-Grace-Vertreter zitieren Johannes 5,24 gerne isoliert, als ob er eine Blankozusage ohne jede Bedingung wäre. Doch schon der unmittelbare Zusammenhang im Kapitel – und erst recht das gesamte johanneische Zeugnis – zeigt klar: Es geht um eine reale Heilswirklichkeit im Jetzt, die aber nur im Bleiben in Christus bewahrt wird.
Hier fallen zwei Dinge auf:
- Jesus spricht vom Hören und Glauben in einer Form, die im Griechischen eine fortdauernde Haltung beschreibt. Es geht nicht um ein „irgendwann mal geglaubt haben“, sondern um eine lebendige Beziehung in der Gegenwart.
- Jesus sagt: „hat ewiges Leben“ – eine Gegenwartsform. Das bedeutet: Der Glaubende hat hier und jetzt Anteil am ewigen Leben. Aber das ist an die Bedingung geknüpft, dass er im Glauben bleibt.
Das bedeutet: Wer im Glauben bleibt, steht jetzt nicht im Gericht. Aber wer Christus den Rücken kehrt und dauerhaft in der Sünde verharrt, stellt sich selbst wieder unter das Gericht.
Das zeigt sich bei Johannes insgesamt. Jesus sagt: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger“ (Joh 8,31). „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht“ (Joh 15,5). „Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so wird auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben“ (1 Joh 2,24–25).
Auch der unmittelbare Kontext von Johannes 5 ist eindeutig. In Vers 24 sagt Jesus: „Wer glaubt, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht.“ Doch in Vers 28–29 heißt es gleich danach: „Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören … die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens; die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts.“
Wenn Jesus von der Auferstehung spricht, unterscheidet er zwei Gruppen: „die Gutes getan haben“ und „die Böses getan haben“. Beide Begriffe stehen im Plural und bezeichnen damit nicht eine einzelne isolierte Tat, sondern das ganze Lebensmuster eines Menschen. Es geht also nicht darum, dass jemand eine einzige „gute Tat“ vollbracht hat, indem er Jesus einmal angenommen hat. Vielmehr verweist Jesus auf die Frucht, die aus der bleibenden Verbindung mit ihm hervorgeht.
Dieses Verständnis fügt sich nahtlos in die Logik des Johannesevangeliums: „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht“ (Joh 15,5). Das Gute ist nicht selbstgemachte Moral, sondern die sichtbare Frucht des Glaubenslebens in Christus. Ebenso zeigen die Johannesbriefe dieselbe Linie: „Jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren“ (1 Joh 2,29). Damit wird klar: Das Gericht unterscheidet nicht nach einem punktuellen „Bekehrungserlebnis“, sondern nach der Wirklichkeit des Glaubens, die sich im Leben erweist.
Die Antwort der Free-Grace Seite
Vertreter der Free-Grace-Lehre verstehen Johannes 5,24 ganz anders. Ihre Argumentation baut auf drei Säulen: einer bestimmten grammatischen Deutung, isolierten Parallelstellen und einem praktischen Einwand.
- Die Worte „der Hörende“ und „der Glaubende“ seien im Griechischen substantivisch zu verstehen – also „die Glaubenden“. Es gehe nicht um fortwährende Haltung, sondern darum, durch einen einmaligen Akt zum Glaubenden zu werden. Mit diesem Schritt sei die Rettung unwiderruflich gesichert.
- Das Wort „hinübergegangen“ im Perfekt zeige, dass der Übergang vom Tod ins Leben ein einmaliger, endgültiger Vorgang sei, der nicht mehr rückgängig gemacht werden könne.
Zur Bestätigung führen sie andere Stellen bei Johannes an. So verweisen sie auf Joh 6,35: „Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern …“ – für sie ein Hinweis auf ein einmaliges Kommen. Ebenso auf Joh 4,14: „Wer von dem Wasser trinkt … wird in Ewigkeit nicht dürsten“ – ihrer Ansicht nach ein einmaliges Trinken. Auch Joh 11,25–26: „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ – wird als Beleg für einen punktuellen Glauben herangezogen. Schließlich noch Joh 10,28: „Ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen“ – für sie ein klarer Beweis endgültiger Sicherheit.
3. Sie bringen einen Praxis-Einwand. „Wer könnte schon immer glauben, immer treu bleiben? Wenn Johannes das meinen würde, wäre Rettung unmöglich. Deshalb kann es nur heißen: Ein einmaliger Glaube genügt.“ Alles Weitere – Bleiben, Frucht, Werke – betreffe höchstens Gemeinschaft und Lohn, nicht das ewige Heil.
Widerlegung der grammatischen Argumentation
Auf den ersten Blick wirkt diese Argumentation geschlossen. Doch bei genauerem Hinsehen erweist sie sich als ein Beispiel für das, was James D. G. Dunn „special pleading“ und „petitio principii“ nennt: unbegründete Sonderausnahmen und Zirkelschlüsse. Grammatisch ist die Deutung nicht zwingend, kontextuell sogar widersprüchlich, und praktisch setzt sie menschliche Erfahrung über das biblische Zeugnis.
Grammatik: Ja, Partizipien können substantivisch gebraucht werden. Doch das sagt nichts über Unwiderruflichkeit. Johannes 3,18 zeigt dieselbe Konstruktion: „Wer glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet.“ Offensichtlich ist hier die gegenwärtige Haltung gemeint, nicht eine punktuelle Entscheidung in der Vergangenheit. Es geht darum, jetzt im Glauben zu stehen oder jetzt nicht zu glauben. Es beschreibt also die aktuelle Haltung, nicht eine Entscheidung, die irgendwann in der Vergangenheit getroffen wurde.
Darum betonen auch alle maßgeblichen Kommentare – katholisch (Brown, Schnackenburg), lutherisch (Bultmann), reformiert (Carson), arminianisch (Witherington), evangelikal (Keener) – dass Johannes von einer bleibenden Haltung des Glaubens spricht. Unterschiede bestehen nur darin, wie Abfall erklärt wird: Die einen sagen, er führe zum Verlust des Heils, die anderen, er zeige ein nie echtes Heil. Doch alle sind sich einig: Bleiben ist notwendig. Kein anerkannter konservativer Kommentar lehrt, man könne Christus verwerfen und dennoch endgültig gerettet sein.
Widerlegung der punktuellen Deutung
Free Grace verweist gern auf Joh 4,14: „Wer trinkt, wird in Ewigkeit nicht dürsten.“ Doch das Aorist „trinken“ beweist keine Punktualität. Johannes selbst benutzt den Aorist auch für Dinge, die lange dauern – etwa für den 46 Jahre währenden Bau des Tempels (Joh 2,20) oder für das „Wohnen“ Christi unter uns (Joh 1,14). Der Aorist allein beweist also gar nichts.
Noch klarer: In Joh 7,37 ruft Jesus ausdrücklich: „… der komme und trinke“ – Präsens-Imperativ, also fortwährend. Free-Grace-Vertreter entgegnen oft, in Joh 4 sei vom „normalen Wasser“ die Rede, das man immer wieder trinken müsse, während das „lebendige Wasser“ Jesu nur ein einziges Mal getrunken werden müsse. Doch Joh 7 spricht ausdrücklich vom lebendigen Wasser – und gerade hier fordert Jesus wiederholtes Trinken. Das Bild verlangt bleibende Teilhabe. Wenn man also Grammatik und Kontext berücksichtigt, reicht es nicht, allein aus Joh 4 eine punktuelle Deutung abzuleiten. Im besten Fall könnte Joh 4 den initialen Beginn des Glaubens beschreiben – doch das gesamte Zeugnis bei Johannes macht klar: Ohne das fortwährende Trinken, das Bleiben und Teilhaben, gibt es kein ewiges Leben. Das lebendige Wasser ist nicht Besitz, den man einmal in die Tasche steckt. Es ist Christus selbst – Quelle und Gegenwart. Wer bleibt, hat Leben. Wer sich abwendet, versiegt. Darum nennt Petrus Abgefallene „ausgetrocknete Quellen“ (2 Petr 2,17).
Widerlegung der Praxis-Einwände: Johannes kennt keinen Glauben ohne Bleiben
Johannes kennt keinen Glauben ohne Bleiben. „Wenn ihr in meinem Wort bleibt …“ (Joh 8,31). „Wer nicht in mir bleibt, wird hinausgeworfen … ins Feuer“ (Joh 15,6). „Wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit“ (Joh 8,51). Das Muster ist binär: Bleiben = Leben; Nicht-Bleiben = Gericht.
Manche Free-Grace-Vertreter spotten: Wenn Glauben und Hören im Präsens stehen, müsste man ja „wie mit Kopfhörern rund um die Uhr hören“, um gerettet zu bleiben. Doch das verkennt die Natur des griechischen Präsens. Es bezeichnet nicht unbedingt eine ununterbrochene Dauerhandlung, sondern oft auch ein iteratives Geschehen – also eine Haltung, die sich wiederholt, auch mit Unterbrechungen. Wer glaubt, ist also derjenige, der im Grundsatz hört und vertraut, nicht jemand, der ohne Pause hört wie bei einer Endlosschleife.
Ein besonders aufschlussreicher Punkt ist der Praxis-Einwand der Free-Grace-Lehre. Man hört ihn oft in der Form: „Wer kann denn schon immer treu bleiben? Niemand schafft das.“ – und genau da beginnt das Problem. Statt mit der Schrift zu starten, beginnt man mit der menschlichen Erfahrung. Erst von dort aus wird die Bibel so gelesen, dass sie ins eigene Schema passt: Wenn wir es nicht schaffen, kann Gott es doch unmöglich verlangen. Also muss ein einmaliger Glaube genügen.
Doch Jesus selbst entlarvt dieses Denken. Als die Jünger fragten: „Wer kann dann gerettet werden?“ (Mt 19,25), gab er nicht nach und senkte die Forderung. Er antwortete: „Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich“ (Mt 19,26). Damit macht er klar: Der Maßstab bleibt bestehen – doch Gott schenkt die Kraft, ihn zu erfüllen.
Zusammenfassung und Abschluss
Die Free-Grace-Argumentation zerfällt an drei Punkten:
- Grammatik – sie ist nicht falsch beobachtet, aber überdehnt und verkürzt. Weder Partizip noch Perfekt beweisen Unwiderruflichkeit.
- Parallelstellen – sie sind falsch angewandt. Joh 4,14 und 6,35 sprechen im Kontext von fortdauernder Teilhabe, nicht punktueller Abholung.
- Praxis – die Erfahrung wird über den Text gestellt. Doch Jesu Antwort verweist auf Gottes Gnade, die zum Bleiben befähigt.
Darum ist Free Grace zu Recht eine extreme Minderheitsmeinung. Alle seriösen konservativen Kommentare – katholisch, lutherisch, reformiert, evangelikal – stimmen darin überein: Glaube bei Johannes ist fortdauernd, Bleiben ist notwendig. Unterschiede gibt es nur in der Deutung des Abfalls, nicht in der Notwendigkeit des Bleibens. Free Grace steht damit isoliert da – als Sonderlehre, die den Text biegt, um ihr Dogma zu retten.