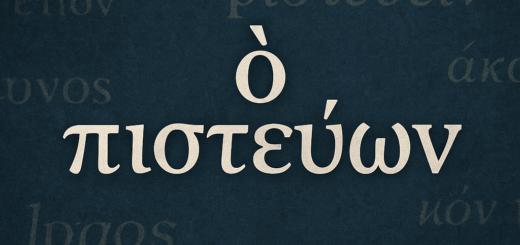Gnade als Kraft zur Erneuerung – Paulus contra Free Grace
„Eine Auslegung, die auf unbegründeten Sonderausnahmen beruht und zudem im Kreis argumentiert (petitio principii), kann niemals überzeugen.“
– James D. G. Dunn
Ich denke, dieses Zitat des protestantischen Theologen James D. G. Dunn fasst meinen Austausch mit Vertretern der sogenannten Free-Grace-Theologie am besten zusammen.
- Unbegründete Sonderausnahmen (special pleading), weil der klare Wortsinn der Schrift vermieden wird, um die eigene Theologie zu retten.
- Petitio principii (Zirkelbeweis), weil von vornherein vorausgesetzt wird, was eigentlich erst durch den Text zu beweisen wäre.
In diesem Artikel will ich einige biblische Stellen durchgehen, die besprochen wurden, um aufzuzeigen, wie das Free-Grace-Lager genau dafür ein Paradebeispiel ist.
Römer 6–8 – Gnade und Heiligung
Im Römerbrief, besonders in den Kapiteln 6 bis 8, beschreibt Paulus das Evangelium als weit mehr als die Vergebung der Schuld. Es eröffnet ein neues Leben im Geist. Christus hat gelitten und sein Blut vergossen, damit wir nicht nur ein „Ticket in den Himmel“ haben, sondern wirklich verwandelt werden und in seiner Kraft leben können.
Von hier aus möchte ich meine grundsätzlichen Bedenken gegenüber dem sogenannten Free-Grace-Evangelium darlegen. Die Vertreter bestreiten nicht, dass Gnade echte Erneuerung und Heiligung schenkt. Ihr Argument lautet: Auch wenn ein Christ diese Gnade später bewusst ablehnt und dauerhaft fleischlich lebt – ja, sogar völlig vom Glauben abfällt –, bleibt er dennoch gerettet. Sie sehen darin eine „noch größere Gnade“, weil diese sogar den Abgefallenen einschließt.
Genau hier liegt das Problem. Paulus beschreibt die Gnade niemals als Freibrief, im Fleisch zu verharren. In Römer 6,16 macht er deutlich, dass man entweder Sklave der Sünde ist „zum Tod“ oder Sklave des Gehorsams „zur Gerechtigkeit“. Damit sagt er nicht, dass Christen niemals sündigen. Auch der Gläubige bleibt schwach und kann fallen. Entscheidend ist aber, ob er im Glauben verharrt und die Sünde durch Gottes Gnade überwindet. Wer dagegen bewusst im Fleisch bleibt, trennt sich von Christus und verliert das Leben, das nur im Geist bewahrt wird.
In Römer 6,22–23 fasst Paulus zusammen, dass die Frucht der Gnade in die Heiligung hineinführt und dass am Ende das ewige Leben steht, während der Lohn der Sünde der Tod ist. Schließlich betont er in Römer 8,13: „Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben.“
Paulus stellt die Konsequenzen also binär dar: Sünde führt zum Tod, Leben im Geist führt zum ewigen Leben. Die wahre Größe der Gnade zeigt sich nicht darin, dass man trotz Verharrens im Fleisch gerettet wird, sondern darin, dass Gnade den Menschen aus der Sünde herauszieht und befähigt, im Geist zu leben.
Das Free-Grace-Evangelium reduziert die Gnade auf eine bloße Zusage, die angeblich auch ohne Heiligung zum ewigen Leben führt. Damit entsteht eine Art „Hyper-Rechtfertigung“, die Rechtfertigung und Gabe des Geistes auseinanderreißt und Heiligung zu einer unverbindlichen Nebensache erklärt. Am Ende wird das Evangelium geschwächt, während Paulus es gerade als Kraft zur wirklichen Erneuerung beschreibt.
Römer 8,17 – Sohnschaft und Erbe
Ein Argument der Free-Grace-Vertreter war ein anschauliches Bild: Gott begnadige nicht nur, sondern adoptiere uns als Söhne und mache uns „adlig“. Diese Stellung bleibe bestehen, auch wenn man später fleischlich lebe. Man könne zwar „enterbt“ werden und so die Belohnung verlieren, aber nicht die Sohnschaft selbst – und damit auch nicht die Rettung.
So schön dieses Bild klingt, es trägt exegetisch nicht. Die Bibel zeigt mehrfach, dass Sohnschaft nicht automatisch bedeutet, auch das Erbe zu behalten. Der Hebräerbrief macht das besonders deutlich am Beispiel Esaus. Er blieb zwar Sohn Isaaks, doch er verlor das Erbe. Sein Verhalten wird nicht als kleine Schwäche dargestellt, sondern als „Unzucht und Gottlosigkeit“ (Hebr 12,16). Weil er sein Erstgeburtsrecht um einer Speise willen verachtete, wurde er verworfen, „obwohl er es unter Tränen suchte“ (Hebr 12,17). Damit wird klar: Das Erbe ist soteriologisch – es geht um Rettung und darum, „den Herrn zu sehen“ (Hebr 12,14). Ohne Heiligung ist das unmöglich. Gerade Esau zeigt, dass Sohnschaft allein nicht genügt: Wer die Gnade verachtet, verliert das Erbe.
Paulus bestätigt diese Sicht. In 1 Kor 6,9–10 erklärt er, dass „Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden“. In Eph 5,5 heißt es, dass kein Unzüchtiger oder Habsüchtiger ein Erbteil im Reich Christi und Gottes hat. Diese Stellen richten sich ausdrücklich an Christen und zeigen: Bestimmte Sünden schließen vom Erbe aus.
Auch Römer 8,17 stützt Free Grace nicht. Paulus schreibt: „Wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben … wenn wir wirklich mit Christus leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden.“ Das Erbe ist also an Treue und Mit-Leiden gebunden. Wer das verweigert, verliert das Erbe – und ohne Erbe gibt es auch kein ewiges Leben.
Darum zeigt die Bibel: Sohnschaft ohne Erbe ist eine Illusion. Free Grace baut hier eine künstliche Trennung auf, die die Schrift nicht kennt. Sohnschaft garantiert nicht das ewige Leben – ohne Heiligung, Umkehr und Treue wird das Erbe verspielt.
Römer 6,21–23 – Fleisch endet im Tod, Geist im Leben
Paulus fragt: „Welche Frucht hattet ihr damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt; denn das Ende davon ist der Tod“ (Röm 6,21). Für ihn ist klar: Das alte Leben im Fleisch endet im Tod, das neue Leben in Christus führt zur Heiligung und zum ewigen Leben. Damit belegt er, dass „Tod“ im Römerbrief nicht bloß irdische Konsequenzen meint, sondern den endgültigen Zustand des Verderbens. Genau deshalb warnt er die Christen in Römer 8,13 mit derselben Konsequenz: Leben im Fleisch endet im Tod, nur das Leben im Geist führt in das ewige Leben.
Die Free-Grace-Vertreter wandten ein, „Tod“ müsse hier nicht den ewigen Tod meinen. Manche erklärten, Paulus meine lediglich den physischen Tod; andere sahen darin ein Bild für den praktischen Umgang mit der Sünde (Kol 3,5) oder eine Beschreibung des inneren Kampfes (Röm 7).
Doch damit verlassen sie den unmittelbaren Kontext. Es ist ein großer Unterschied, ob Paulus vom „Tod“ als Endzustand spricht (Röm 6,21–23; 8,13) oder im Imperativ auffordert, die Sünde abzutöten (Kol 3,5). Paulus gebraucht „Tod“ im Römerbrief konsequent im Gegensatz zum ewigen Leben (vgl. Röm 6,16.21.23; 8,13). Er redet nicht von Schande, Prozess oder bloßem physischem Tod, sondern vom endgültigen Ausgang: „Wer nach dem Fleisch lebt, wird sterben.“
Die Free-Grace-Vertreter versuchten dann, die Begriffe „ewiges Leben“ und „Tod“ systematisch aufzuschlüsseln. Ewiges Leben sei einerseits das Geschenk, das man beim Glauben empfängt, andererseits aber eine „Qualität“, in der man zunehmen könne, verbunden mit Belohnung und Herrschaft. Entsprechend erklärten sie den Tod in vier Bedeutungen:
- als soteriologischen Tod (den sie aber für Römer 6 und 8 ausdrücklich ausschlossen),
- als physischen Tod
- als funktionale Schande bzw. Nutzlosigkeit im Dienst,
- als endzeitlichen Verlust von Freude und Belohnung – jedoch ohne Verlust des Heils.
Damit ist das Ergebnis klar: Ein Christ bleibt gerettet, ganz gleich, ob er im Geist oder im Fleisch lebt; Tod bedeutet für ihn höchstens Schande, Zucht oder Verlust von Herrschaft. Genau das macht das Problem dieser Argumentation aus. Anstatt den Römerbrief im Zusammenhang zu lesen, legen sie eine Liste möglicher Bedeutungen über den Text, um ihn so zu entschärfen. Doch Paulus gebraucht „Tod“ im Römerbrief konsequent im Gegensatz zum ewigen Leben. Er redet nicht von Schande oder Belohnungsverlust, sondern vom endgültigen Ausgang: „Wer nach dem Fleisch lebt, wird sterben.“
Johannes 15 – Frucht oder Feuer
Jesus sagt: „Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen“ (Joh 15,6).
Die Free-Grace-Vertreter deuteten das „Feuer“ als Bild für irdisches Gericht oder Verlust. „Bleiben“ bedeute Gemeinschaft und Gebetserhörung, nicht ewige Rettung.
Doch der Zusammenhang zeigt: Es geht um das Schicksal derer, die nicht in Christus bleiben. Das Bild „hinausgeworfen – ins Feuer“ ist im NT klar soteriologisch (vgl. Mt 3,10; 13,40; Offb 20,15). Der Einwand einer „word concept fallacy“ greift hier nicht, denn es geht nicht um ein einzelnes Wort, sondern um dasselbe Bild mit derselben Handlung: fruchtlos – abgeschnitten – ins Feuer.
Dass das AT „Feuer“ oft für zeitliche Strafen gebraucht, stimmt. Aber das NT entfaltet die volle Bedeutung: Feuer wird durchgehend als Bild für das Endgericht gebraucht. Jesus selbst sagt: „Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen“ (Mt 7,19). Ebenso in Mt 13,40–42: „Wie nun das Unkraut gesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein.“ Und in Offb 20,15 heißt es: „Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen.“ Darum ist „Bleiben“ keine Option für mehr „Lebensqualität“, sondern die Bedingung für das ewige Leben (Joh 15,6; vgl. Joh 15,10).
Galater 6,8 – Verderben oder ewiges Leben
Man könnte meinen, Paulus’ Aussage sei glasklar: „Wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten“ (Gal 6,8). Doch nach Free Grace ist hier angeblich nicht das eigentliche ewige Leben gemeint, sondern nur eine besondere „Qualität“ oder ein „Lohn“.
Das ist ein klassisches Beispiel für special pleading: eine unbegründete Sonderausnahme, nur um das eigene System zu retten. Denn Paulus gebraucht den Begriff „ewiges Leben“ durchgehend soteriologisch, als den endgültigen Zustand der Rettung (vgl. Röm 2,7; 5,21; 6,22–23; 1 Tim 6,12; Tit 1,2; Tit 3,7). Wenn Free Grace behauptet, gerade Galater 6,8 meine plötzlich etwas anderes, dann liegt die Beweislast klar bei ihnen.
Der Gegensatz bei Paulus ist eindeutig: Verderben oder ewiges Leben – beides Endzustände, keine bloßen Abstufungen. Dasselbe bestätigt er schon wenige Verse zuvor: „Die Werke des Fleisches sind offenbar … wer solches tut, wird das Reich Gottes nicht erben“ (Gal 5,19–21).
Das „Reich Gottes“ ist bei Paulus untrennbar mit Heil und endgültiger Rettung verbunden. Es ist zwar schon gegenwärtig erfahrbar – „denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist“ (Röm 14,17), – bleibt aber zugleich eschatologische Hoffnung: „Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen“ (Apg 14,22). Darum verkündete Paulus das Evangelium immer zusammen mit dem Reich Gottes (Apg 19,8; 20,25; 28,31).
Auch Jesu Begegnung mit dem reichen Jüngling (Mt 19,16–25) bestätigt, dass das ewige Leben nicht unabhängig vom Lebenswandel geerbt wird. Dort werden „ewiges Leben“, „Reich Gottes“ und „Errettung“ synonym verwendet.
Wenn Paulus also schreibt, dass Unzüchtige, Götzendiener oder Habgierige das Reich Gottes nicht erben (1 Kor 6,9–10; Eph 5,5–6), dann geht es nicht um eine verschlechterte „Lebensqualität“, sondern um den Verlust des Heils selbst.
Damit ist klar: Für Paulus gilt konsequent – Fleisch führt ins Verderben, der Geist ins ewige Leben (Gal 6,8).
Zusammenfassung und Abschluss
Im ganzen Austausch zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Die Free-Grace-Auslegung lebt von unbegründeten Sonderausnahmen und Zirkelschlüssen.
Unbegründete Sonderausnahmen (special pleading): Immer dann, wenn der klare Wortsinn (Tod = ewiger Tod, ewiges Leben = ewige Rettung, Feuer = Gericht) gegen ihr System spricht, wird behauptet, hier sei „etwas anderes gemeint“. Doch diese Behauptungen bleiben ohne exegetische Grundlage.
Petitio principii (Zirkelbeweis): Von Anfang an wird vorausgesetzt, dass ein Christ sein Heil nicht verlieren könne – und genau dieses Dogma bestimmt dann die Auslegung jeder einzelnen Stelle.
Das Grundproblem ist: Free Grace macht die Gnade kleiner, nicht größer. Anstatt Gnade als verwandelnde Kraft zu verstehen, die den Menschen aus der Sünde herausführt und in die Gemeinschaft mit Christus stellt, reduziert man sie auf eine bloße Zusage ohne Konsequenzen. Das Evangelium wird dadurch abgeschwächt.
Paulus dagegen lehrt konsequent: Fleisch führt zum Tod, der Geist zum Leben. Jesus selbst warnt: „Wer nicht in mir bleibt, wird hinausgeworfen … und ins Feuer geworfen“ (Joh 15,6). Paulus drückt denselben Ernst aus: „Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben“ (Röm 8,13). Und auch im Galaterbrief sagt er klar: „Wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten“ (Gal 6,8). Säen im Fleisch bringt Verderben, säen im Geist ewiges Leben.
Gnade ist somit nicht nur ein äußeres Versprechen, sondern eine innere Wirklichkeit, die Frucht hervorbringt. Jesus selbst sagt in Joh 15,5: „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Es ist also Christus selbst, der in uns wirkt, damit wir nicht unfruchtbar bleiben.
Die Free-Grace-Lehre betont zwar ebenfalls, dass Gnade Veränderung bewirken kann. Doch ihr entscheidender Zusatz ist: Auch wer diese Gnade völlig zurückweist und im Abfall verharrt, bleibe dennoch endgültig gerettet. Genau hier liegt der Bruch mit dem biblischen Zeugnis.
Damit drängt sich die entscheidende Frage auf: Wenn die Heilsgnade nicht schon jetzt Heiligkeit bewirkt – welche „Heilsgnade“ soll dann die Heiligkeit im Himmel hervorbringen? Wenn es Gott bei seiner Errettung nur um das Juristische ginge, warum sollten wir dann im Himmel heilig sein? Wenn aber der Himmel Heiligkeit erfordert, wieso sollte diese dann nicht schon auf Erden beginnen – besonders, wenn man nicht einmal an ein Fegefeuer glaubt?
Im Unterschied dazu bleibt die Botschaft des Neuen Testaments klar und einheitlich: Gottes Gnade ist kein bloßes Etikett, sondern eine Kraft, die den Menschen verwandelt. Sie macht ihn fähig, in Christus zu bleiben, Frucht zu bringen und im Geist zu leben. Das Evangelium ist mehr als eine juristische Fiktion – es ist der Weg der realen Erneuerung, die in der Heiligung auf Erden beginnt und in der ewigen Gemeinschaft mit Gott vollendet wird.
Damit bleibt die entscheidende Frage an Free Grace: Warum sollte man Texte, die in sich klar und binär sind, so uminterpretieren, dass sie das Gegenteil dessen aussagen, was Paulus und Jesus deutlich warnend verkünden?
Der Leser sieht: Die Schwäche der Free-Grace-Position liegt nicht in einzelnen Versen, sondern in der Methode selbst – sie muss den klaren Zusammenhang der Schrift beugen, um ihre eigene These zu retten.